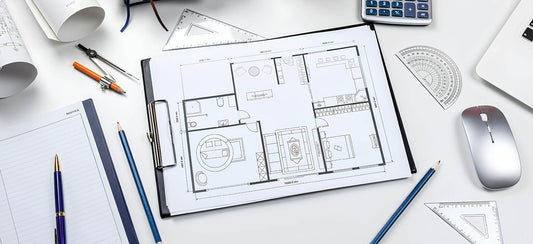Edelstahlschornsteine – Eigenschaften, Montage und Pflege
Teilen
Allgemeine Informationen
Edelstahlschornsteine sind Schornsteinsysteme aus rostfreiem Stahl. Sie bestehen meist aus modularen Rohrsegmenten, die zu einem Abgassystem zusammengesetzt werden. Verwendet werden sie, um Rauch- und Abgase von Heizgeräten wie Kaminen, Öfen oder Heizkesseln sicher ins Freie abzuleiten.
Ein an einer Hauswand montierter doppelwandiger Edelstahlschornstein (Außenschornstein). Aufgrund ihres Materials sind Edelstahlschornsteine widerstandsfähig gegen Witterung und Korrosion. Man findet sie sowohl in Neubauten als auch bei Nachrüstungen in Bestandsgebäuden – insbesondere dann, wenn kein gemauerter Schornstein vorhanden ist oder ein zusätzlicher Ofen installiert werden soll. Ihre Beliebtheit resultiert vor allem aus der einfachen Montage und der hohen Flexibilität: Edelstahlkamine lassen sich vergleichsweise leicht nachträglich an einem Gebäude anbringen, ohne dass umfangreiche Baumaßnahmen im Inneren nötig sind. Auch optisch fügen sich die glänzenden Metallrohre oft unauffällig an der Fassade ein und verleihen dem Haus einen modernen Akzent.
Vorteile von Edelstahlschornsteinen
Edelstahlschornsteine bieten gegenüber traditionellen gemauerten Schornsteinen und anderen Alternativen eine Reihe von Vorteilen. Im Folgenden sind die wichtigsten Pluspunkte aufgeführt:
- Korrosionsbeständigkeit: Edelstahl ist rostfrei und sehr widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Säuren. Im Betrieb eines Schornsteins entsteht leicht Kondensat mit Ruß und anderen Verbrennungsrückständen, die bei gemauerten Schächten zu Versottung (Durchfeuchtung und Verschwärzung des Mauerwerks) führen können. Ein Edelstahlschornstein hingegen nimmt kaum Feuchtigkeit auf und bleibt innen trocken, sodass keine Schäden durch aggressive Kondensate entstehen. Dadurch ist die Lebensdauer eines Edelstahlschornsteins in der Regel sehr hoch.
- Einfache und schnelle Installation: Die Montage eines Edelstahlschornsteins ist deutlich unkomplizierter und schneller als der Bau eines gemauerten Schornsteins. Die Bauteile werden als Fertigelemente geliefert, die vor Ort nur noch zusammengesetzt und an der Wand befestigt werden müssen. Das geringe Gewicht der Edelstahlrohre erleichtert die Handhabung. Oft kann ein Außenschornstein innerhalb eines Tages installiert werden. Aufwändige Maurerarbeiten oder statische Verstärkungen des Gebäudes entfallen, da keine schweren Steine verbaut werden müssen.
- Hohe Anpassungsfähigkeit: Edelstahlschornsteine sind modular aufgebaut und in verschiedenen Durchmessern, Längen und Ausführungen erhältlich. Dadurch lassen sie sich flexibel an die baulichen Gegebenheiten und den Aufstellort der Feuerstätte anpassen. Es gibt Winkelstücke und Bögen, um Hindernisse zu umgehen, sowie verschiedene Halterungen für Wand- oder Bodenmontage. Auch bei der Platzierung bieten sie Spielraum: Sie können außen an der Fassade entlang geführt oder im Inneren des Gebäudes (zum Beispiel durch Schächte oder Wände) verlegt werden. Diese Flexibilität macht Edelstahlschornsteine zur idealen Lösung, um nachträglich einen Kaminofen oder eine Heizung in Betrieb zu nehmen, wenn kein gemauerter Schornstein vorhanden ist.
- Für viele Brennstoffe geeignet: Ein weiterer Vorteil ist die breite Einsetzbarkeit. Edelstahlschornsteine eignen sich grundsätzlich für alle gängigen Brennstoffe und Heizsysteme – von Holz, Pellets und Kohle bis hin zu Öl- oder Gasheizungen. Das Material hält sowohl hohen Abgastemperaturen von Holzöfen stand als auch der feuchten, leicht säurehaltigen Abluft moderner Gas-Brennwertgeräte. Wichtig ist hierbei lediglich, die passende Ausführung des Edelstahlschornsteins zu wählen (z. B. mit spezieller Dichtung oder Kondensatablauf für Brennwerttechnik). Im Allgemeinen bietet ein Edelstahlschornstein aber eine sehr universelle Lösung für verschiedenste Feuerstätten.
- Geringer Platzbedarf und nachträglicher Einbau: Da Edelstahlkamine in der Regel außen am Gebäude verlaufen, sparen sie Innenraum. Es muss kein Schornsteinschacht im Haus eingeplant oder freigeräumt werden. Das ist besonders vorteilhaft bei Renovierungen, wenn im Hausinneren kein Platz für einen gemauerten Kamin vorhanden ist. Der Außenschornstein kann an der Fassade hochgeführt werden, wodurch im Wohnraum keine Fläche verloren geht. Zudem kann er auch in engem Bauraum installiert werden, da der Durchmesser eines Edelstahlrohrs kleiner ausfallen kann als die Innenmaße eines gemauerten Schornsteins, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.
- Kostenersparnis: In vielen Fällen ist ein Edelstahlschornstein kostengünstiger als ein konventioneller Schornstein aus Ziegeln. Das Material selbst ist zwar hochwertig, aber durch die standardisierte Fertigung und die einfachere Montage entstehen insgesamt oft geringere Kosten. Gerade bei einer Nachrüstung entfallen teure Umbauten im Gebäudeinneren. Auch die Wartung kann effizienter sein, da die glatte Innenfläche Ablagerungen reduziert (dazu später mehr). Insgesamt erhält man also für vergleichsweise wenig Geld eine langlebige und sichere Abgasanlage.
Zusammenfassend punktet der Edelstahlschornstein mit Robustheit, Flexibilität und einfacher Handhabung. Diese Eigenschaften erklären, warum er heute bei Neubau und Nachrüstung so verbreitet ist.
Installation
Die Installation eines Edelstahlschornsteins kann in vielen Fällen selbst von geübten Heimwerkern durchgeführt werden, jedoch sollten Planung und Endabnahme immer unter Einbeziehung fachkundiger Personen erfolgen (in Deutschland insbesondere dem Bezirksschornsteinfegermeister). Bei der Montage sind mehrere Schritte wichtig, um einen sicheren und vorschriftsmäßigen Betrieb zu gewährleisten. Im Allgemeinen umfasst der Einbau folgende Schritte:
- Planung und Vorbereitung: Zunächst steht die Planung an. Hierbei wird festgelegt, wo der Schornstein verlaufen soll und welche Höhe er haben muss. Man klärt, ob der Edelstahlschornstein innen oder außen geführt wird und welche Bauteile (Durchführungen, Halterungen, Bogenstücke) benötigt werden. In dieser Phase ist es ratsam, den zuständigen Schornsteinfeger einzubeziehen. Er kann beraten, ob die geplante Position und Höhe den Vorschriften entspricht, und er teilt mit, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Außerdem wird in der Planungsphase der passende Durchmesser des Rohrsystems bestimmt – abhängig von der angeschlossenen Feuerstätte und der erforderlichen Schornsteinhöhe, um ausreichend Zug/Draft zu erzielen.
- Montagevorbereitung am Gebäude: Bevor der eigentliche Schornstein aufgebaut wird, sind Vorarbeiten am Gebäude nötig. Dazu gehört zum Beispiel das Bohren der Kernbohrung bzw. Öffnung in der Außenwand, durch die das Ofenrohr ins Freie gelangen soll. Innen muss an der Aufstellstelle des Ofens ein Wanddurchbruch erstellt werden, an dem das Verbindungsstück (Ofenrohr) zum Edelstahlschornstein angeschlossen wird. Für die Außenmontage werden an der Fassade Montagepunkte festgelegt: Es wird eine Wandkonsole oder Bodenplatte als unterer Träger des Schornsteins angebracht, die das Gewicht der Konstruktion tragen kann. Entlang der geplanten Schornsteinroute an der Wand werden Befestigungsschellen bzw. Wandhalter in bestimmten Abständen (meist alle 2 bis 3 Meter) montiert. Diese geben dem Rohr später Halt und Stabilität. Sind Deckendurchführungen oder Dachdurchbrüche erforderlich (bei Innenführung), werden auch diese Öffnungen jetzt geschaffen und mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Brandschutzmanschetten, Wandfutter, Dachdurchführungselemente) vorbereitet.
- Zusammenbau der Rohrsegmente: Nun erfolgt der eigentliche Aufbau des Edelstahlschornsteins. In der Regel beginnt man unten mit einem T-Stück: Dies ist ein Rohrstück in T-Form, das den Anschluss des Ofenrohres ermöglicht und nach unten eine Reinigungsöffnung hat. Dieses T-Stück wird auf der vorbereiteten Wandkonsole oder Bodenplatte montiert und mit einer Klemmschelle fixiert. Anschließend werden die geraden Rohrsegmente Stück für Stück nach oben angebracht. Jedes Segment wird ineinandergesteckt und mit Klemmbändern oder Schellen gesichert, sodass eine dichte Verbindung entsteht. Bei einem doppelwandigen Edelstahlschornstein ist darauf zu achten, dass die Isolierung in den Rohrsegmenten unbeschädigt bleibt und dicht abschließt, um keine Wärmebrücken zu erzeugen. Falls im Verlauf Bogenstücke (Winkel) vorgesehen sind – zum Beispiel um ein Dachüberstand zu umgehen – werden diese an der entsprechenden Stelle eingefügt. Wichtig ist, die zuvor angebrachten Wandhalter zu nutzen: Während das Rohr hochgezogen wird, fixiert man es in regelmäßigen Abständen an diesen Halterungen. So ist der Schornstein fest mit der Wand verbunden und kann nicht wackeln. Bei einer Innenmontage innerhalb von Geschossen wird ähnlich vorgegangen, jedoch muss hier das Rohr durch Zwischendecken geführt und dort mit Brandschutzverkleidungen geschützt werden.
- Dachdurchführung und Abschluss: Erreicht der Schornstein die Dachkante oder einen Dachüberstand, kommt ein Dachdurchführungselement zum Einsatz. Dieses Spezialteil dichtet die Stelle ab, an der das Rohr durchs Dach tritt, damit kein Regenwasser eindringen kann. Für geneigte Dächer gibt es entsprechende schräg zugeschnittene Bleischürzen oder Formteile, die unter den Dachziegeln montiert werden. Nachdem der Schornstein die Dachhaut passiert hat, wird das letzte Rohrsegment auf die erforderliche Höhe gebracht. In vielen Fällen muss das Rohr mindestens 40 cm über den Dachfirst hinausragen (bei schrägen Dächern ab einer bestimmten Neigung), damit die Rauchgase ausreichend verweht werden und kein Rauchaustritt in Dachnähe bleibt. Zum Abschluss wird auf die oberste Öffnung eine Regenhaube oder ein Funkenschutzgitter gesetzt, sofern dies gewünscht und zulässig ist. Diese Haube verhindert, dass Niederschlag direkt in den Schornstein läuft, und dient gegebenenfalls als Funkenfang (wichtig, wenn mit Holz gefeuert wird und trockenes Funkenflug-Risiko besteht). Nicht zuletzt werden alle Verbindungen noch einmal auf festen Sitz geprüft.
- Prüfung und Inbetriebnahme: Ist der Schornstein komplett montiert, folgt die Abnahme durch den Schornsteinfeger (in Deutschland vorgeschrieben). Der Bezirksschornsteinfeger kontrolliert, ob die Montage fachgerecht und nach den geltenden Brandschutzvorschriften erfolgt ist. Er überprüft beispielsweise die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, die korrekte Höhe der Mündung über dem Dach und die Dichtheit der Verbindungen. Erst wenn er sein OK gibt und die Anlage abgenommen hat, darf der Edelstahlschornstein in Betrieb genommen und der angeschlossene Ofen tatsächlich befeuert werden. Zum Abschluss sollte der Besitzer noch die Dokumentation und eventuell mitgelieferte Unterlagen (wie CE-Zertifikat oder Montageanleitung) aufbewahren, da diese Nachweise über die Normgerechtigkeit des Schornsteins enthalten.
Während der gesamten Installation ist sorgfältiges Arbeiten unerlässlich. Alle Verbindungen müssen dicht sein, und die Konstruktion muss standsicher befestigt werden. Im Zweifel sollte man einzelne Schritte einem Fachbetrieb überlassen – gerade das Durchbrechen von Wänden und Dächern erfordert Erfahrung, um keine statischen oder dichtungstechnischen Probleme zu verursachen. Insgesamt jedoch ist der Aufwand überschaubar, verglichen mit dem Bau eines gemauerten Schornsteins, und mit guter Vorbereitung lässt sich ein Edelstahlschornstein zügig montieren.
Gesetzliche Vorschriften
Beim Einbau und Betrieb von Edelstahlschornsteinen sind verschiedene gesetzliche Vorgaben und technische Normen zu beachten. Diese Regelungen dienen vor allem dem Brandschutz und dem Immissionsschutz (Vermeidung von Rauchbelästigung). In Deutschland greifen im Wesentlichen folgende Bestimmungen:
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV): Diese Verordnung regelt unter anderem die Anforderungen an kleine und mittlere Feuerungsanlagen (wie Kaminöfen) und damit auch an die Ableitung ihrer Abgase. So sind dort zum Beispiel Bestimmungen festgelegt, wie hoch ein Schornstein über dem Dach öffnen muss, damit Rauchgase sich gut verteilen. Für Wohngebäude schreibt die 1. BImSchV in der Regel vor, dass Schornsteinmündungen bei Dächern mit mehr als 20° Neigung mindestens 40 cm über dem Dachfirst liegen müssen. Damit wird sichergestellt, dass Rauch und Abgase vom Wind weggetragen werden und sich nicht am Boden sammeln. Bei Flachdächern galt früher oft ein Mindestmaß (z. B. 1 m über Dach), wobei aktuelle Regeln und regionale Vorschriften hier variieren können. Wichtig ist, dass die Position des Schornsteins so gewählt wird, dass angrenzende höhere Bauteile oder Nachbargebäude nicht ungünstig beeinflusst werden (Stichwort: Rauchgasfahne und Anströmung). Die genauen Höhenanforderungen können je nach Bundesland und Bauordnung unterschiedlich sein, weshalb die Beratung durch den Schornsteinfeger oder ein Blick in die Landesbauordnung ratsam ist.
- Landesbauordnung und Feuerungsverordnung: Jedes deutsche Bundesland hat eigene Bauordnungen und oft zusätzliche Feuerungsverordnungen, die Detailvorschriften für Schornsteine enthalten. Darin sind beispielsweise die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen festgelegt. Ein Edelstahlschornstein – vor allem im Innenbereich oder nahe an Holzteilen – muss einen bestimmten Abstand zu Balken, Verkleidungen oder Möbeln einhalten, damit diese sich nicht durch die Abgaswärme entzünden. Bei doppelwandig gedämmten Edelstahlrohren sind die erforderlichen Abstände relativ gering (oft im Bereich einiger Zentimeter, z. B. 5–10 cm), da die Außentemperatur des Rohrs niedrig bleibt. In den Produktunterlagen der Hersteller sind diese Abstandsmaße angegeben. Gelten jedoch laut Landesvorschrift strengere Werte als vom Hersteller genannt, müssen natürlich die strengeren Werte eingehalten werden. Umgekehrt dürfen geringere Abstände als gesetzlich vorgegeben auch dann nicht unterschritten werden, wenn ein Hersteller dies erlauben würde. Neben Abständen regeln die Verordnungen auch, dass Abgasanlagen dicht und feuersicher sein müssen und ggf. witterungsbeständig (gerade bei Außenkaminen). Ein weiterer Punkt ist die Frage einer Baugenehmigung: In manchen Bundesländern ist das Anbringen eines außenliegenden Schornsteins genehmigungsfrei, solange gewisse Bedingungen (Höhe, Abstand zum Nachbargrundstück etc.) erfüllt sind. Anderswo kann eine Bauanzeige oder -genehmigung verlangt sein. Daher sollte man sich immer vorab beim örtlichen Bauamt erkundigen oder eben den Schornsteinfeger um Hilfe bitten.
- DIN-Normen und CE-Kennzeichnung: Edelstahlschornsteine unterliegen europäischen Normen, insbesondere der DIN EN 1856 (für metallische Abgassysteme) sowie DIN V 18160 (für Planung und Ausführung von Abgasanlagen in Gebäuden). Ein in Deutschland verkauftes Schornsteinsystem aus Edelstahl muss eine CE-Kennzeichnung tragen, die bestätigt, dass es den einschlägigen Normen entspricht. Diese Normen betreffen z. B. die Temperaturbeständigkeit, Korrosionsklasse des Stahls, die Dichtigkeit und die Dämmung. Als Käufer sollte man darauf achten, dass das gewünschte System zertifiziert ist. In der Praxis erfüllen alle namhaften Hersteller diese Vorgaben. Die Einhaltung der Normen bedeutet auch, dass bei korrekter Installation die Brandsicherheit gewährleistet ist. Dennoch entbindet das CE-Zeichen nicht davon, die Montage nach Vorschrift vorzunehmen – beides gehört zusammen.
Zusätzlich zu den oben genannten Vorschriften können regionale Bebauungspläne oder besondere Auflagen (z. B. in einem Reetdachgebiet strengere Funkenflugschutz-Vorschriften) relevant sein. Zusammengefasst sollte man immer den zuständigen Schornsteinfeger in die Planung einbeziehen. Dieser Fachmann kennt die lokalen Bestimmungen und kontrolliert später die fertige Anlage. Er wird auch die Betriebsfreigabe nur erteilen, wenn alle Regeln eingehalten sind. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Edelstahlschornstein nicht nur effizient funktioniert, sondern auch rechtlich und sicherheitstechnisch einwandfrei ist.
Kosten
Anschaffungskosten: Die Kosten für einen Edelstahlschornstein setzen sich aus den Materialkosten für das Schornsteinsystem selbst und den Montagekosten zusammen. Einfachere Komplettsets für außen montierte Edelstahlschornsteine (doppelwandig, inklusive Wandhalterungen und Regenhaube) sind bereits ab etwa 500 Euro erhältlich. Dabei handelt es sich meist um kürzere Systeme für einstöckige Gebäude oder für niedrigere Anschlüsse. Für höhere Gebäude (zwei Stockwerke und mehr) oder hochwertigere Ausführungen können die Materialkosten entsprechend steigen – gängige Preisspannen liegen dann ungefähr zwischen 1.000 und 1.500 Euro für ein komplettes Schornsteinsystem. Faktoren wie die Höhe des Schornsteins (also die Anzahl der benötigten Rohrsegmente), der Durchmesser (größerer Durchmesser ist teurer) und spezielle Bauteile (z. B. doppelwandiges Rohr mit extra starker Isolierung, besonders korrosionsbeständige Stahllegierung, farbige Beschichtung oder Designhauben) beeinflussen den Preis. Ein einwandiger Edelstahlschornstein – meist eingesetzt als Einsatz zur Sanierung eines bestehenden gemauerten Kamins – ist deutlich günstiger, da weniger Material (keine Dämmung) benötigt wird. Solche Einsätze kosten häufig nur 100 bis 200 Euro pro laufendem Meter Rohr, je nach Durchmesser und Qualität. Ein typischer Altbau-Schornstein von 8 m könnte also in Edelstahl ein gutes Stück unter 1.000 Euro kosten, wenn man ihn innenliegend saniert. Für Außenkamine (doppelwandig isoliert) rechnet man grob mit 200 bis 300 Euro pro Meter (Material). Das bedeutet, ein 6 m hoher Edelstahlschornstein außen am Haus liegt vom Material her etwa im Bereich 1.200 bis 1.800 Euro. Diese Zahlen sind Richtwerte – nach oben gibt es teurere Premium-Produkte, aber im Allgemeinen bewegen sich die meisten Standard-Modelle im genannten Rahmen.
Installationskosten: Zusätzlich zu den Materialkosten fallen Kosten für die Montage an, sofern man diese nicht selbst durchführt. Die Montagekosten können je nach Region, Anbieter und Aufwand variieren. Bei einer unkomplizierten Installation an einer zugänglichen Außenwand kann ein versierter Handwerker den Edelstahlschornstein in wenigen Stunden errichten. Einige Anbieter rechnen nach Metern ab; durchschnittlich kann man mit circa 100 Euro pro Meter Schornstein an Montagekosten rechnen. Das würde für einen 6 m hohen Schornstein rund 600 Euro bedeuten. Allerdings können Zusatzarbeiten diesen Preis erhöhen: Muss zum Beispiel ein Durchbruch durch die Decke oder das Dach erstellt werden, kommen zusätzliche Kosten für diese Arbeit hinzu (vielleicht einige hundert Euro, je nach Aufwand und notwendiger Wiederherstellung von Dachabdichtungen oder Wandverkleidungen). Auch ein Gerüst für Arbeiten in größerer Höhe oder besonders schwierige Befestigungen (z. B. an einem wärmegedämmten Haus, wo spezielle Dübel und Distanzhalter gebraucht werden) können den Preis erhöhen. Im Durchschnitt liegen die Gesamtkosten für Material und professionelle Montage in Deutschland meist irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro für einen nachträglich angebrachten Edelstahlschornstein an einem Ein- oder Zweifamilienhaus. Wenn man handwerklich geschickt ist, kann man durch Eigenleistung die Montagekosten reduzieren. Viele Händler bieten Selbstbausätze an, und mit sorgfältiger Befolgung der Montageanleitung sowie unter Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist ein Selbstaufbau möglich. Allerdings sollten Laien nur dann selbst Hand anlegen, wenn sie sich der Sache wirklich sicher sind, da Fehler gravierende Folgen haben können (Brandschutz!). Eventuell kann man auch einen Mittelweg wählen: manche erledigen die einfachen Vorarbeiten selbst (Bohrungen, Gerüst stellen) und überlassen den kritischen Aufbau den Profis – so lassen sich ebenfalls Kosten sparen.
Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen: Preisunterschiede ergeben sich nicht nur aus der Länge, sondern auch aus der Ausführung des Schornsteins. Doppelwandige Edelstahlschornsteine (mit integrierter Wärmedämmung) sind teurer als einwandige Rohre, bieten dafür aber die Möglichkeit der Außenmontage und einen sichereren Betrieb (weniger Abkühlung der Abgase, geringere Außentemperatur des Rohrs). Innerhalb der doppelwandigen Modelle gibt es Unterschiede in der Dämmstärke – üblich sind etwa 30 mm Isolierung; hochwertigere Systeme haben 50 mm oder mehr, was die Preise erhöht, aber die Wärmedämmeigenschaften verbessert. Auch die Qualität des Edelstahls spielt eine Rolle: Gängige Edelstahlschornsteine bestehen aus V2A-Stahl (Werkstoff 1.4301), während für sehr anspruchsvolle Bedingungen (z. B. bei besonders feuchten Abgasen oder in Meeresnähe mit salzhaltiger Luft) V4A-Stahl (1.4571) eingesetzt wird, der noch korrosionsbeständiger ist. V4A-Produkte sind etwas teurer. Zudem kann die äußere Optik Unterschiede machen – Standard ist blanker, glänzender Edelstahl; wer es weniger auffällig mag, kann pulverbeschichtete Varianten in Dachfarbe oder matte Oberflächen wählen, was in der Regel einen Aufpreis bedeutet. Zusammengefasst hat man eine breite Auswahl: Vom einfachen preiswerten Standardrohr bis zum Premium-Schornsteinsystem mit zusätzlicher Ausstattung. In jedem Fall sollte man beim Kauf nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Prüfsiegel und Zulassungen achten – das günstigste Modell nützt nichts, wenn es den örtlichen Vorschriften nicht entspricht oder nicht abgenommen wird.
Wartung und Pflege
Edelstahlschornsteine sind in der Regel sehr pflegeleicht. Durch das glatte Innenrohr setzen sich Ruß und Ablagerungen weniger stark fest als in rauem Mauerwerk, und das Material selbst ist unempfindlich gegenüber den üblichen Witterungseinflüssen. Dennoch bedarf auch ein Edelstahlschornstein regelmäßiger Wartung, um die Sicherheit und Funktion über viele Jahre zu gewährleisten.
An erster Stelle steht hier die regelmäßige Reinigung durch den Schornsteinfeger. Gesetzlich ist in Deutschland vorgeschrieben, dass genutzte Schornsteine in festen Intervallen gekehrt und überprüft werden. Je nach Art der Feuerstätte und dem Brennstoff sind die Intervalle unterschiedlich: Bei einem Holzofen beispielsweise kommt der Schornsteinfeger oft zweimal im Jahr, bei Gasheizungen eventuell nur einmal im Jahr oder sogar alle zwei Jahre. Der Schornsteinfeger kehrt den Schornstein mit speziellen Bürsten, wodurch Ruß, Asche und eventuelle Teerablagerungen entfernt werden. Diese Reinigung ist wichtig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen – Rußablagerungen könnten sich sonst entzünden und einen gefährlichen Kaminbrand verursachen. Dank der Reinigungsklappe am unteren T-Stück des Edelstahlschornsteins kann der gelöste Ruß bequem entfernt werden. Für den Besitzer bedeutet das nur, den Zugang zur Reinigungsöffnung freizuhalten und dem Profi den Rest zu überlassen.
Neben der Reinigung sollte eine regelmäßige Sichtkontrolle des Edelstahlschornsteins erfolgen. Von außen kann man überprüfen, ob die Rohrsegmente noch fest miteinander verbunden und die Halterungen an der Wand stabil sind. Besonders nach Unwettern oder starkem Wind lohnt sich ein Blick, ob alle Schellen fest sitzen und die Konstruktion unbeschädigt ist. Edelstahl ist zwar rostfrei, dennoch sollte man achten, ob sich irgendwo Verfärbungen oder Flugrost zeigen – insbesondere an Schnittkanten oder Verbindungsschellen kann es bei geringerer Materialgüte mal zu leichtem Rostansatz kommen. In solch seltenen Fällen empfiehlt es sich, frühzeitig gegenzusteuern (Reinigung mit Edelstahlpflegemittel oder Austausch eines betroffenen Segmentes), bevor sich ein Schaden ausbreitet.
Die äußere Oberfläche des Edelstahlschornsteins benötigt kaum Pflege. Bei Bedarf kann man sie mit Wasser und mildem Reinigungsmittel säubern, falls sich Staub oder Schmutz abgesetzt hat. Aggressive Reiniger (z. B. Chlorhaltiges) sollte man unbedingt vermeiden, da sie die Passivschicht des Edelstahls angreifen könnten. Normalerweise genügt es, den Schornstein der Optik wegen alle paar Jahre einmal abzuwischen. Wer eine lackierte oder beschichtete Variante hat, kontrolliert am besten ebenfalls alle paar Jahre den Zustand der Beschichtung – im Regelfall sind diese aber wetterfest ausgeführt.
Wichtig für die lange Lebensdauer eines Edelstahlschornsteins ist auch der richtige Betrieb der angeschlossenen Feuerstätte. Man sollte nur zugelassene Brennstoffe verwenden (kein Müll oder feuchtes Holz verbrennen), da unsaubere Verbrennung zu stärkerem Säureanfall und Ablagerungen führen kann, was selbst Edelstahl auf Dauer belasten könnte. Bei modernen Brennwertheizungen, die Abgase mit sehr viel Feuchtigkeit produzieren, ist meist ein Kondensatablauf im Schornstein integriert; dieser sollte gelegentlich kontrolliert und entleert werden, damit sich kein Wasser im Rohr sammelt.
Zusammengefasst erfordert ein Edelstahlschornstein wenig Aufwand: Die Hauptarbeit übernimmt der Schornsteinfeger durch die vorgeschriebenen Kehrungen. Wenn man als Betreiber darauf achtet, dass nur geeignete Brennstoffe verbrannt werden und ab und zu einen prüfenden Blick auf das Schornsteinsystem wirft, hat man in der Regel über Jahrzehnte eine zuverlässige Abgasanlage. Die robuste Bauweise und das resistente Material tragen dazu bei, dass Edelstahlkamine oft viele Jahre praktisch wartungsfrei funktionieren. Lediglich die Sicherheitsüberprüfungen und Reinigungen in vorgeschriebenen Intervallen sollte man konsequent durchführen lassen. So bleibt der Edelstahlschornstein dauerhaft sicher und effizient.
Edelstahlschornsteine sind eine moderne, vielseitige Lösung für die Ableitung von Rauchgasen. Sie verbinden eine einfache Montage mit hoher Langlebigkeit und Sicherheit. Ob bei der Ausstattung eines Neubaus oder der Nachrüstung eines Kaminofens im Altbau – mit einem Schornstein aus Edelstahl erhält man ein zuverlässiges System, das den aktuellen technischen und gesetzlichen Anforderungen entspricht. Dank ihrer Vorteile wie Korrosionsbeständigkeit, Flexibilität und geringem Gewicht setzen sich Edelstahlschornsteine immer mehr durch. Bei Planung und Installation sollte man zwar Sorgfalt walten lassen und die geltenden Vorschriften beachten, doch mit der richtigen Vorbereitung ist der Weg zum eigenen Edelstahlschornstein nicht kompliziert. Hat man ihn einmal in Betrieb, sorgt eine minimal aufwändige Pflege dafür, dass man viele Jahre Freude und vor allem Sicherheit beim Betrieb seines Ofens oder Kamins haben wird. Ein Edelstahlschornstein stellt somit eine lohnende Investition dar, wenn es darum geht, wohnliche Wärme und behagliches Feuer im eigenen Zuhause sicher genießen zu können.