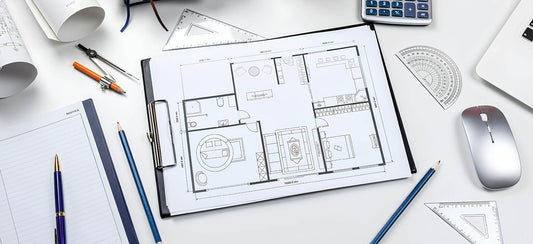Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr – verständlich erklärt
Teilen
Viele Hausbesitzer denken nicht täglich an ihren Schornstein – bis Probleme auftreten. Eine Schornsteinsanierung wird dann zum Thema. Doch was bedeutet das eigentlich und warum ist sie wichtig? In diesem Artikel erklären wir verständlich, aber informativ, warum ein Schornstein saniert werden muss, warum gerade ein Edelstahlrohr dabei ideal ist, wie die Sanierung abläuft und worauf man achten sollte. Technische Begriffe werden dabei so erklärt, dass jeder sie verstehen kann.
Warum kann eine Schornsteinsanierung nötig sein?
Es gibt mehrere Gründe, warum ein Schornstein im Laufe der Zeit saniert werden muss. Hier die häufigsten Ursachen im Überblick:
- Versottung: Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Verschwärzung des Schornsteins. Sie entsteht, wenn im Schornstein Feuchtigkeit und Teer aus den Abgasen kondensieren und ins Mauerwerk eindringen. Man erkennt Versottung an gelb-braunen Flecken und einem unangenehmen Geruch an der Schornsteinwand. Sie schadet der Bausubstanz und kann auf Dauer die Statik beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung vom Schornsteinfeger beugt zwar vor, doch oft hilft langfristig nur eine Sanierung, um das Problem zu lösen.
- Rußablagerungen und Rußbrand: Bei der Verbrennung, vor allem von Holz, entsteht Ruß. In einem alten, gemauerten Schornstein können sich mit der Zeit dicke Rußschichten ablagern – insbesondere wenn seltener gereinigt wird oder viel feuchtes Holz verbrannt wird. Diese Ablagerungen erhöhen das Risiko eines Schornsteinbrandes (auch Rußbrand genannt), bei dem sich der Ruß im Schornstein entzündet. Ein solcher Brand kann extreme Hitze entwickeln und umliegende Bauteile in Brand setzen. Wenn der Schornstein stark mit Ruß zugesetzt ist, wird oft eine Sanierung nötig, um ihn wieder sicher betreiben zu können.
- Risse und Schäden am Schornstein: Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und jahrelanger Gebrauch hinterlassen Spuren. Risse im Mauerwerk, abgeplatzte Steine oder undichte Stellen können auftreten. Durch solche Schäden können heiße Abgase in Wände oder Wohnräume gelangen – ein erhebliches Sicherheitsrisiko (Stichwort Kohlenmonoxid- und Brandgefahr). Außerdem verschlechtern Risse den Zug (die Luftströmung) im Kamin. In vielen Fällen lassen sich solche Schäden durch das Einziehen eines Edelstahlrohrs beheben, da das Rohr die undichten oder bröckeligen Stellen überbrückt.
- Neue Heizsysteme: Die Umrüstung auf eine moderne Heizung (z. B. eine Niedertemperatur- oder Brennwertheizung, die Abgase stark abkühlt, oder ein Pellet-/Holzofen) macht oft eine Schornsteinanpassung nötig. Alte Schornsteine haben einen relativ großen Querschnitt und sind für hohe Abgastemperaturen ausgelegt. Moderne Heizkessel hingegen leiten kühlere Abgase in den Schornstein. Dadurch kann im breiten Schacht der Rauch zu stark abkühlen, kondensieren und wiederum Versottung verursachen. Ein engeren Edelstahlrohr im Schornstein stellt den optimalen Querschnitt für den neuen Heizkessel her: Die Abgase bleiben wärmer, ziehen besser ab und Feuchtigkeit schlägt sich nicht mehr nieder.
(Allgemein kann auch die Erneuerung der äußeren Schornsteinverkleidung oder das Entfernen gesundheitsgefährdender Altmaterialien wie Asbest eine Sanierung notwendig machen. In den meisten modernen Fällen steht jedoch die Verbesserung der Betriebssicherheit und Effizienz im Vordergrund.)
Vorteile eines Edelstahlrohrs bei der Sanierung
Warum ausgerechnet ein Einsatz aus Edelstahl? Ein Edelstahlschornstein als Innensanierung bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:
- Korrosions- und säurebeständig: Edelstahl ist rostfrei und unempfindlich gegenüber Säuren. Die im Rauch enthaltenen aggressiven Stoffe (wie Teer, Säuren aus Kondensat) können dem Edelstahlrohr kaum etwas anhaben. Das schützt das Mauerwerk vor weiterer Versottung und verlängert die Lebensdauer des Schornsteins erheblich.
- Hitzebeständig und brandsicher: Edelstahlrohre halten sehr hohe Temperaturen aus. Sollte es doch einmal zu einem Rußbrand kommen, bleibt das Rohr intakt und verhindert, dass Feuer auf die Gebäudestruktur übergreift. Insgesamt erhöht ein Edelstahlrohr die Brandsicherheit, weil brennbarer Ruß sich darin schlechter festsetzen kann als in rauem Mauerwerk.
- Besserer Zug und Effizienz: Die glatte Innenfläche des Edelstahlrohrs begünstigt den Rauchabzug. Außerdem kann man den passenden Durchmesser des Rohrs genau auf die Heizquelle abstimmen. Beides führt dazu, dass die Heizung effizienter arbeitet, weniger Abgasverluste auftreten und weniger Schadstoffe oder Feuchtigkeit im Schornstein verbleiben. Das bedeutet auch weniger Heizkosten und Emissionen.
- Universal für verschiedene Brennstoffe: Edelstahlschornsteine eignen sich für fast alle Brennstoffe – egal ob Holz, Pellets, Öl oder Gas. Das Rohr verträgt die hohen Abgastemperaturen eines Kaminofens genauso wie die feuchten, kühlen Abgase eines Gas-Brennwertkessels. Diese Flexibilität macht Edelstahl zur idealen Sanierungslösung bei unterschiedlichsten Feuerstätten.
- Schnelle, saubere Montage: Im Vergleich zu einer kompletten Neuerrichtung des Schornsteins ist das Einziehen eines Edelstahlrohres meist in wenigen Stunden bis Tagen erledigt. Es sind keine großen Abriss- oder Bauarbeiten am Haus nötig, da das Rohr im bestehenden Schacht verlegt wird. Das bedeutet weniger Schmutz, Lärm und Kosten. Viele Systeme werden als Bausatz geliefert, was die Montage zusätzlich erleichtert (dennoch sollte sie fachgerecht erfolgen, dazu gleich mehr).
- Kostenersparnis auf lange Sicht: Durch die Sanierung werden Folgeschäden (feuchtes Mauerwerk, bröckelnde Steine) vermieden. Zudem muss ein solcher Schornstein seltener repariert werden. Langfristig sparen Hausbesitzer somit Geld, weil der Edelstahl-Einsatz den Schornstein dauerhaft stabilisiert und schützt.
Die wichtigsten Schritte der Sanierung mit Edelstahlrohr
Wenn man sich für eine Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr entschieden hat, läuft das Projekt typischerweise in mehreren Schritten ab. Hier ein Überblick von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung:
- Zustand prüfen: Am Anfang steht eine gründliche Inspektion des bestehenden Schornsteins. Ein Fachmann (oft der Schornsteinfeger oder ein Schornsteinbau-Handwerker) schaut sich den Schacht von oben bis unten an. Dabei wird geprüft, ob Versottung vorliegt, ob Risse oder Hindernisse im Inneren vorhanden sind und wie der generelle bauliche Zustand ist. Außerdem werden Maße genommen: Die Höhe und der Querschnitt des Schornsteins müssen bekannt sein, um das passende Rohr zu wählen.
- Planung: In der Planungsphase wird festgelegt, wie saniert wird. Wichtig ist die Auswahl des richtigen Systems und Rohrdurchmessers. Hierbei spielen die Art der Heizquelle und die gesetzlichen Vorgaben eine Rolle. Mit Hilfe von Berechnungsprogrammen oder Tabellen ermittelt man den idealen Durchmesser des Edelstahlrohrs, damit später der Abzug optimal funktioniert. Zudem wird geplant, wo Reinigungsöffnungen hinkommen (in der Regel unten am Schornstein) und auf welcher Höhe das Ofenanschluss-Stück sitzen muss. In dieser Phase stimmt man sich auch mit dem Schornsteinfeger ab – in Deutschland muss dieser die Sanierung nämlich genehmigen bzw. am Ende abnehmen. Häufig ist es nötig, die Maßnahme vorab beim Bezirksschornsteinfeger anzumelden (oft über ein Formular mit technischen Angaben zur Feuerungsanlage).
- Auswahl des passenden Edelstahlrohrs: Edelstahlrohr ist nicht gleich Edelstahlrohr. Es gibt verschiedene Sanierungssysteme. Meist wird ein einwandiges Edelstahlrohr innerhalb des gemauerten Schachts verwendet (das Mauerwerk übernimmt die Isolierung nach außen). Falls der Kamin verwinkelt ist, kommen flexible Edelstahlrohre zum Einsatz, die sich den Biegungen anpassen können. In besonderen Fällen (etwa wenn der Schornstein frei an der Außenwand entlang geführt wird) nutzt man doppelwandige Rohre, die bereits gedämmt sind. Bei der Auswahl spielen auch die Materialstärke und Legierung eine Rolle – hochwertige Edelstähle (z. B. V4A-Stahl) mit ausreichender Wandstärke sind teurer, aber besonders langlebig. All diese Entscheidungen werden idealerweise mit Beratung durch eine Fachfirma getroffen. Am Ende wird ein passender Sanierungssatz (Bausatz) bestellt, der alle benötigten Komponenten enthält – vom Rohr selbst über Anschlussstücke bis zur Regenhaube.
- Einbau des Edelstahlrohrs: Jetzt geht es an die eigentliche Montage. Zunächst müssen an den vorgesehenen Stellen Öffnungen im Schornstein geschaffen werden. Für gewöhnlich wird im unteren Bereich eine Öffnung für die Reinigungstür herausgestemmt und an der Stelle, wo der Ofen angeschlossen wird, eine weitere Öffnung für das T-Stück (den seitlichen Rohrabgang zum Ofen) geschaffen. Anschließend beginnt der Einbau: Von unten nach oben werden spezielle Elemente eingesetzt. Unten kommt meist eine Kondensatschale hinein, die später any auftretendes Kondenswasser auffängt. Darauf folgt ein Reinigungselement mit Tür, um den Schornstein künftig fegen zu können. Daran schließt das T-Stück an, das durch die seitliche Öffnung mit dem Ofenrohr verbunden wird. Nun wird das eigentliche Edelstahlrohr (meist aus mehreren Segmenten) von oben in den Schacht eingelassen. Oft montiert man mehrere Rohrsegmente vor und lässt sie an einem Seil vorsichtig in den Schornstein hinab. Dabei ist darauf zu achten, dass das Rohr mittig im Schacht bleibt und nicht an der Mauer anliegt – hierfür werden Abstandhalter oder Klemmschellen verwendet. Segment für Segment wird so das Rohr bis zum Schornsteinausgang geführt und miteinander verbunden. Schließlich ragt oben das Rohr etwas heraus.
- Abschluss und Abnahme: Sind alle Bauteile eingebaut, wird der Schornstein oben wieder verschlossen. Am Schornsteinkopf montiert man eine Abdeckung mit Regenhaube (oft aus Edelstahl), die das Eindringen von Wasser verhindert und den Spalt zwischen Rohr und Mauerwerk abdeckt. Die zuvor aufgebrochene Öffnung in der Wand (für das T-Stück und die Reinigungstür) wird wieder zugemauert bzw. sauber verblendet, nachdem die entsprechenden Komponenten eingebaut sind. Nun folgt der entscheidende letzte Schritt: die Abnahme. Der Bezirks-Schornsteinfeger inspiziert den sanierten Schornstein gründlich. Er überprüft, ob das Edelstahlrohr fachgerecht installiert und dicht ist, ob der Querschnitt passt und alle Vorschriften eingehalten wurden. Erst wenn dieser Fachmann sein Okay gibt, darf der Schornstein in Betrieb genommen werden. Damit ist die Sanierung abgeschlossen und der frisch sanierte Kamin bereit für den Einsatz.
Allgemeine Herausforderungen und Lösungen
Bei einer Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr können je nach Situation verschiedene Herausforderungen auftreten. Hier einige typische Probleme und wie man sie löst:
- Verwinkelter oder versetzter Schornstein: In älteren Häusern verläuft der Schornsteinzug nicht immer schnurgerade nach oben. Es kann kleine Versätze oder Knicke geben. Ein starres Rohr lässt sich dort nicht ohne Weiteres einführen. Lösung: In solchen Fällen verwendet man flexible Edelstahlrohre, die biegsam sind und sich an den Verlauf anpassen. Alternativ kann man den Schornstein an der Versatzstelle auch von außen öffnen, um das Rohr dort hindurchzuführen. Wichtig ist, vorher genau zu prüfen, wie der Verlauf ist – der Schornsteinfeger oder Installateur macht dazu oft eine Kamerabefahrung.
- Enger Schachtquerschnitt: Manchmal ist der vorhandene Kaminquerschnitt nur knapp größer als der Durchmesser des benötigten Edelstahlrohrs. Das Einziehen wird dann sehr fummelig, weil kaum Spielraum ist. Lösung: Hier hilft es, den Schornstein vorab gründlich zu reinigen und lose Mauerteile zu entfernen, um jeden Millimeter zu gewinnen. Gegebenenfalls kann man auf ein etwas kleineres Rohr ausweichen – allerdings muss der Querschnitt noch zur Heizung passen (daher immer Fachberatung!). Im Extremfall muss der Schornsteinquerschnitt baulich erweitert werden, was allerdings aufwändig ist. Meist bekommt man das Edelstahlrohr aber mit Geduld und den richtigen Techniken hinein. Wichtig ist, dass das Rohr nirgends klemmt oder schief hängt.
- Feuchtigkeit und Kondensatbildung: Gerade bei der Umstellung auf eine Heizung mit kühleren Abgasen fällt im Schornstein verstärkt Kondenswasser an. Das kann beim Betrieb als Tropfen unten austreten, wenn keine Vorkehrung getroffen wird. Lösung: Das Edelstahl-System sollte immer eine Kondensatsammelstelle (Schale) mit Ablauf haben. Darüber kann das Wasser entweder verdunsten oder kontrolliert abgeleitet werden. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, den Edelstahl-Einsatz mit Dämmmaterial zu ummanteln (soweit Platz ist), damit die Abgase nicht zu schnell auskühlen. Diese Wärmedämmung ist besonders bei Außenkaminen wichtig. So bleibt der Schornstein innen trocken.
- Beschädigtes oder brüchiges Mauerwerk: Wenn der gemauerte Schornstein schon sehr alt oder durch Versottung stark in Mitleidenschaft gezogen ist, muss man aufpassen, dass bei der Sanierung keine weiteren Schäden entstehen. Loses Mauerwerk könnte beim Einbau herabfallen oder Hohlräume hinterlassen. Lösung: Vor dem Einsetzen des Rohrs werden lose Teile entfernt und Risse evtl. mit feuerfestem Mörtel ausgebessert. Es gibt auch Verfahren, bei denen der Schornstein vorab durch spezielle Harz- oder Mörtelinjektionen abgedichtet und stabilisiert wird, bevor das Rohr hinein kommt. Das Edelstahlrohr selbst überbrückt dann Risse und gibt dem Schacht neue Stabilität. Bei sehr maroden Schornsteinen kann als Alternative auch ein neuer Außenschornstein an der Fassade montiert werden, anstatt den alten Schacht zu verwenden.
(Weitere mögliche Herausforderungen sind z. B. das Arbeiten in großer Höhe auf dem Dach – hier ist unbedingt auf Absturzsicherung zu achten –, oder die Koordination, wenn mehrere Feuerstellen an einen Schornstein angeschlossen sind. Solche Fälle sollte man immer mit Fachleuten planen.)
Gesetzliche Vorschriften beachten
Eine Schornsteinsanierung ist kein Vorhaben, das man einfach nach Lust und Laune durchführt – Gesetze und Verordnungen sorgen dafür, dass alles sicher abläuft. In Deutschland unterliegen Schornsteine den Bauordnungen der Länder und der Feuerungsverordnung. Wichtig: Bevor man den Schornstein umbaut oder ein Edelstahlrohr einbaut, muss der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger informiert werden. Dieser berät zu den Anforderungen und überprüft die Planung. Oft ist es erforderlich, ein Formular mit den technischen Daten der geplanten Anlage einzureichen. Spätestens nach Abschluss der Arbeiten ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger Pflicht. Dabei kontrolliert er, ob der neue Edelstahl-Innenzug zugelassen (CE-zertifiziert) ist, ob der Querschnitt stimmt, die Höhe passt (es gibt vorgeschriebene Schornsteinhöhen über dem Dach) und ob alle Brandschutzabstände eingehalten werden. Ohne seine Freigabe darf der Kamin nicht in Betrieb gehen. Es lohnt sich also, den Schornsteinfeger von Anfang an miteinzubeziehen – so ist man auf der sicheren Seite.
Sicherheit geht vor
Bei allem, was mit Feuer und Abgasen zu tun hat, steht die Sicherheit an erster Stelle. Durch eine Edelstahlrohr-Sanierung steigert man die Sicherheit bereits deutlich: Das Abgas wird zuverlässig nach draußen geführt, ohne in Wände oder Zimmer zu entweichen. Die Gefahr von Kaminbränden durch Rußablagerungen sinkt. Dennoch muss man einige Punkte beachten. Die Montage sollte nur von erfahrenen Handwerkern oder unter professioneller Anleitung erfolgen – schon aus Eigeninteresse. Arbeiten am Dach in großer Höhe sind gefährlich (Sturzgefahr!), und Fehler beim Einbau könnten später zu Undichtigkeiten führen. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Bauteile zugelassen und hitzebeständig sind (insbesondere Dichtmassen, falls solche benutzt werden, müssen hochtemperaturfest sein). Während der Nutzung des sanierten Schornsteins sollte weiterhin nur geeigneter Brennstoff verbrannt werden (kein Müll, kein triefend nasses Holz), um Schäden oder übermäßige Ablagerungen zu vermeiden. Und selbstverständlich gilt: Kohlenmonoxid-Warner im Haus und regelmäßige Kontrollen durch den Schornsteinfeger tragen zusätzlich zur Sicherheit bei.
Wartung des sanierten Schornsteins
Auch ein mit Edelstahl ausgekleideter Schornstein braucht Pflege – wenn auch weniger als ein alter Ziegelkamin. Regelmäßige Kehrung und Prüfung stehen weiterhin auf dem Programm. In Deutschland schreibt der Bezirksschornsteinfeger je nach Art der Feuerstätte vor, in welchen Abständen gereinigt werden muss (häufig ein- bis zweimal jährlich bei festen Brennstoffen, bei Gasheizungen mindestens alle paar Jahre zur Kontrolle). Dank der glatten Rohrinnenfläche lassen sich Ruß und Ablagerungen aber viel leichter entfernen. Die Reinigung erfolgt durch die Reinigungsöffnung: der Schornsteinfeger kehrt von oben und kann den Ruß unten über die Reinigungstür entnehmen. Hausbesitzer selbst sollten hin und wieder einen Blick auf leicht zugängliche Teile werfen – etwa kontrollieren, ob die Regenhaube oben noch fest sitzt und frei von Laub oder Vogelnestern ist. Bei Heizsystemen, die Kondensat erzeugen (z. B. Brennwertthermen), sollte man außerdem den Kondensatbehälter gelegentlich leeren oder prüfen, ob der Ablauf frei ist. Insgesamt ist der Wartungsaufwand aber gering. Wichtig ist: Niemals darauf verzichten, den Schornstein regelmäßig prüfen zu lassen, auch wenn alles problemlos läuft – diese Routine garantiert eine lange Freude am sanierten Schornstein.
Eine Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr ist eine nachhaltige Investition in die Sicherheit und Effizienz Ihres Hauses. Sie verhindert weitere Schäden durch Feuchtigkeit oder Ruß, verbessert den Abzug Ihrer Heizanlage und stellt sicher, dass Sie den Kamin bedenkenlos nutzen können. Trotz der anfänglichen Kosten und Arbeit zahlt es sich aus, den Schornstein rechtzeitig zu modernisieren. So haben Sie im Winter ein warmes Zuhause – und das gute Gefühl, dass alles technisch und sicherheitlich auf dem neuesten Stand ist.