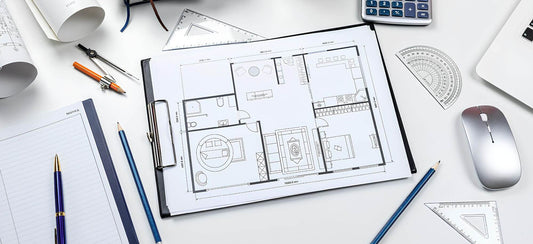Die besten Holzsorten für den Kaminofen
Ein knisterndes Kaminfeuer an einem frostigen Abend – das ist pure Gemütlichkeit. Damit der Kaminofen aber wirklich wohlige Wärme spendet und nicht zum Rauchgenerator wird, kommt es auf die richtige Holzart an. Nicht jedes Holz brennt gleich gut: Unterschiede in Brennwert, Glutbildung und Verbrennungsverhalten entscheiden darüber, wie effizient und sauber Ihr Feuer brennt. In diesem Ratgeber schauen wir uns an, welche Holzsorten sich am besten für den Kamin eignen, welche man lieber nicht verfeuert, und was bei Nachhaltigkeit, Lagerung und Preis zu beachten ist. Freuen Sie sich auf sachkundige Infos – garniert mit einem augenzwinkernden Tipp hier und da – für Ihren nächsten gemütlichen Kaminabend.
Hartholz vs. Weichholz – Unterschiede im Brennverhalten
Hartholz oder Weichholz? Diese grundlegende Frage steht am Anfang jeder Kaminholz-Wahl. Harthölzer stammen von Laubbäumen (z.B. Buche, Eiche, Esche), Weichhölzer von Nadelbäumen (z.B. Fichte, Kiefer, Tanne). Der Unterschied liegt vor allem in der Holzdichte und im Harzgehalt – und genau die beeinflussen das Verhalten im Ofen:
- Harthölzer sind dicht und schwer. Sie enthalten viel Material pro Scheit, was einen hohen Brennwert bedeutet – sprich: mehr Wärmeenergie pro Volumen. Ein Stück Buche liefert z.B. deutlich mehr Wärme als ein gleich großes Stück Fichte. Hartholz brennt langsamer und gleichmäßiger ab, bildet eine langlebige Glut und hält die Wärme über lange Zeit. Ihr Ofen muss seltener nachgelegt werden, und das Feuer bleibt stetig. Im Grunde ist Hartholz der Marathonläufer unter den Brennstoffen: ausdauernd, zuverlässig und stark in der Hitzeentwicklung. Nachteil: Durch die hohe Dichte zündet Hartholz etwas gemächlicher – man muss ihm beim Anfeuern ein wenig mehr Geduld (und Anzündholz) gönnen. Außerdem ist hochwertiges Hartholz oft teurer in der Anschaffung.
- Weichhölzer sind leichter, weniger dicht und oft harzhaltig. Sie lassen sich sehr leicht entzünden und brennen anfangs mit lebhaftem Feuer – ideal, um schnell Wärme in den Raum zu bringen. Weichholz gibt in kurzer Zeit viel Hitze ab, kühlt aber auch rasch wieder aus, weil es schneller abbrennt. Man kann sagen, Weichholz ist der Sprinter: es legt einen rasanten Start hin, ist aber ebenso flott verfeuert. Der hohe Harzanteil in Nadelhölzern führt zu knackendem Knistern und Funkenflug – was in einem offenen Kamin für ein unerwünschtes Feuerwerk sorgen kann. Auch lagert sich durch das Harz mehr Ruß im Schornstein ab, sodass häufiger gereinigt werden muss. Positiv am Weichholz: Es ist meist günstiger zu bekommen und leichter zu spalten. Viele nutzen Fichte & Co. gerne als Anzündholz oder mischen es bei, um schnell ein Feuer in Gang zu bringen, das dann mit Hartholz weiterbrennt. Für den Dauerbetrieb eines Kaminofens allein ist Weichholz weniger geeignet, weil man ständig neues Holz nachlegen müsste. Kurz gesagt: Weichholz bietet den schnellen Wärme-Kick, Hartholz die langanhaltende Wärme.
Empfehlenswerte Holzarten für gemütliche Kaminfeuer
Unter den Harthölzern gibt es ein paar Klassiker, die sich als Kaminfutter besonders bewährt haben. Sie verbinden hohen Heizwert mit schönem Flammenbild und angenehmer Glut. Im deutschsprachigen Raum zählen insbesondere Buche, Eiche und Birke zu den Favoriten, doch auch andere Laubhölzer wie Esche, Ahorn oder Obstbaumhölzer leisten hervorragende Dienste im Ofen.
- Buche: Buchenholz ist quasi der Goldstandard unter den Brennhölzern. Es hat einen sehr hohen Brennwert (ca. 2100 kWh pro Raummeter bei lufttrockenem Holz) und brennt gleichmäßig und lange. Die Flammen von Buche sind ruhig und hell, und es bildet eine kräftige Glut, die viel Wärme nachliefert. Dabei entwickelt Buchenholz kaum Funkenflug oder übermäßigen Rauch – ideal auch für offene Kamine. Ein weiterer Pluspunkt: Gut getrocknete Buche lässt sich relativ leicht entzünden (für ein Hartholz) und verbreitet eine angenehme, neutrale Holzwärme ohne starken Harzgeruch. In vielen Regionen ist Buche gut verfügbar und aufgrund ihrer hervorragenden Allround-Eigenschaften die erste Wahl für Kaminbesitzer.
- Eiche: Eichenholz steht in Sachen Heizwert Buche in nichts nach – tatsächlich liegt der Energiegehalt sogar minimal höher. Eiche brennt sehr langsam und heiß und sorgt für eine ausgedehnte Glutphase, die Stunden nach dem Anzünden noch Wärme liefert. Wer also ein Holz sucht, das über Nacht im Ofen lange vor sich hin glimmt, ist mit Eiche richtig beraten. Das Feuerbild ist etwas zurückhaltender als bei Buche, dafür gibt Eiche jene gemütliche „hörbare Wärme“ in Form von kräftigem Knistern. Es gibt allerdings zwei Dinge bei Eiche zu beachten: Erstens muss Eichenholz sehr gut getrocknet sein (idealerweise 2-3 Jahre Lagerung), da es viel Gerbsäure enthält. Ist es noch zu feucht, führt diese Gerbsäure zu starkem Rauch und Ablagerungen im Schornstein (Stichwort Versottung). Zweitens neigt Eiche beim Abbrennen dazu, kleine Glutstücke zu spritzen. In einem geschlossenen Kaminofen ist das unproblematisch, aber bei offenen Kaminen sollte man aufpassen oder ein Funkenschutzgitter verwenden. Richtig gelagert und im passenden Ofen aber ist Eiche ein vorzügliches Brennholz für langanhaltende Wärme.
- Birke: Birkenholz erkennt man schon an seiner weiß-silbrigen Rinde – und genau diese enthält ätherische Öle, die Birke zu einem besonderen Kaminholz machen. Birke lässt sich schnell entzünden und brennt zunächst mit lebhaften, hellen Flammen. Diese Flamme hat einen leicht bläulichen Schimmer, dem Öl in der Rinde sei Dank, was fürs Auge sehr reizvoll ist. Zwar hat Birke einen etwas niedrigeren Brennwert pro Volumen (rund 1900 kWh/rm, also etwa 10–15 % weniger als Buche), doch dafür trocknet Birkenholz schneller durch und gibt seine Wärme zügig ab. Es bildet etwas weniger Glut als Buche oder Eiche, brennt aber immer noch langsamer ab als die meisten Weichhölzer. Ein großer Vorteil: Kaum Funkenflug. Trockene Birke verbrennt relativ ruhig, ohne spritzende Harzfunken (Birke enthält kaum Harz) – darum ist sie für offene Kamine besonders beliebt. Zudem verbreitet Birkenholz beim Brennen einen angenehmen Duft, den viele mit gemütlichen Kaminabenden verbinden. Kurz: Birke ist ein tolles Kaminholz, um schnell eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, ohne auf allzu viel Gluthaltung verzichten zu müssen.
- Esche: Das Holz der Esche steht in der Gunst der Kaminbesitzer ebenfalls weit oben. Eschenholz hat ähnlich hohe Heizwerte wie Buche, brennt dabei ruhig und gleichmäßig ab und bildet eine lang anhaltende Glut. Esche lässt sich gut spalten und trocknet etwas schneller als Eiche. Im Abbrand verhält sie sich unspektakulär (was positiv ist): kein übermäßiges Knistern, wenig Funken, aber solide Wärme. Oft wird Eschenholz sogar zusammen mit Buche verkauft oder verheizt, da beide sich sehr ähneln in ihrer Performance. Wenn Sie Esche bekommen können, machen Sie als Kaminholz damit nichts falsch.
- Ahorn und Obsthölzer: Ahornholz (von Spitzahorn, Bergahorn etc.) sowie Obstbaumhölzer wie Apfel, Kirsch oder Pflaume sind ebenfalls gut geeignete Brennstoffe. Sie liegen vom Brennwert her leicht unter Buche, überzeugen aber durch schöne Flammenbilder und teils angenehme Düfte. Kirschholz z.B. verbrennt mit einem lebendigen, leicht grünlich-blau flackernden Feuer – eine kleine Farbshow im Kamin – und verströmt ein mildes Aroma. Obstbaumholz fällt oft an, wenn alte Bäume im Garten weichen müssen: Anstatt es zu häckseln, kann man es wunderbar in Stücke gesägt im Kamin nutzen. Da diese Hölzer meist in geringeren Mengen anfallen, nutzt man sie gern als Beimischung für besondere Abende. Ihre Heizleistung ist solide, auch wenn man etwas häufiger nachlegen muss als bei Eiche oder Buche.
Hinweis: Neben den genannten zählen noch weitere Harthölzer zu den Premium-Brennstoffen – etwa Robinie (auch falsche Akazie genannt) oder Hainbuche (Weißbuche). Robinienholz ist extrem hart und bietet ähnlich wie Eiche einen hervorragenden Brennwert mit langer Brenndauer, kommt jedoch nicht überall vor. Hainbuche hat sogar einen der höchsten Brennwerte unter den heimischen Hölzern, ist aber ebenso schwer zu spalten wie das Holz selbst schwer ist. In der Praxis greift man meist zu Buche, Eiche, Esche, Birke & Co., da diese gut verfügbar sind und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Ungeeignete Holzarten – was man lieber nicht verfeuern sollte
Nicht alles, was brennt, darf oder soll auch im Kaminofen landen. Es gibt Holzarten und Materialien, die ungeeignet oder sogar verboten sind, weil sie entweder dem Ofen schaden, ineffizient sind oder gesundheitsgefährdende Stoffe freisetzen. Hier die wichtigsten No-Gos:
- Harzreiche Nadelhölzer (Fichte, Kiefer, Tanne etc.) in Mengen: Zwar sind Fichten- oder Kiefernscheite brennbar, doch wie oben erwähnt bringen sie einige Nachteile mit. Der starke Funkenflug und das Knistern können gefährlich werden – gerade offen brennende Kamine könnten Funken ins Zimmer sprühen. Zudem führt das Harz zu verstärkter Rußbildung im Kamin und im Schornstein, was die Reinigungshäufigkeit erhöht und im schlimmsten Fall zu Versottung beitragen kann. Hinzu kommt der geringere Brennwert pro Volumen: Wer ausschließlich mit Nadelholz heizt, verbraucht viel mehr Holz und läuft Gefahr, dass das Feuer schnell wieder ausgeht. Als Anzündholz oder Beimischung ist Nadelholz in Ordnung (sogar hilfreich), aber für stundenlange Kaminabende greift man besser auf Hartholz zurück. Möchten Sie dennoch vorhandenes Weichholz verwerten, achten Sie darauf, dass es durchgetrocknet ist und nutzen Sie es nur in geschlossenen Öfen – dann bleiben Funken wo sie hingehören.
- Feuchtes oder frisches Holz: Ein häufiger Fehler ist das Verbrennen von Holz, das noch nicht ausreichend getrocknet ist. Waldfrisches Holz enthält oft 50% und mehr Feuchtigkeit. Wenn Sie so ein Scheit ins Feuer legen, passiert Folgendes: Statt gemütlich zu brennen, fängt das Holz an zu zischen und zu qualmen, weil die Energie erst das Wasser im Holz verdampfen muss. Die Flamme kämpft gegen den Wasserdampf – Wärmeabgabe gleich Null, stattdessen zieht eine Fahne aus Rauch durch den Schornstein. Feuchtes Holz bringt kaum Heizleistung, erzeugt massiv Ruß und Teerablagerungen und kann sogar zu Schimmelbildung im Ofen führen. Die Emissionen an Schadstoffen steigen ebenfalls drastisch, da das Holz unvollständig verbrennt. Kurz gesagt: Nasses Holz im Kamin ist, als würde man dem Feuer eine kalte Dusche verpassen – es raucht beleidigt vor sich hin, aber warm wird keinem dabei. Daher gilt: Holz immer lufttrocken (unter ~20% Restfeuchte) verheizen. Im Zweifel das Brennholz länger lagern oder mit einem Feuchtemessgerät prüfen, bevor es ins Ofenfeuer wandert.
- Behandeltes, verschmutztes oder fremdes Material: Der Kaminofen ist kein Mülleimer auf Temperatur – beschichtetes oder chemisch behandeltes Holz hat darin nichts zu suchen! Alte lackierte Möbelstücke, gestrichene Bretter, imprägnierte Zaunreste oder verleimte Holzspanplatten setzen beim Verbrennen giftige Dämpfe frei (u.a. Chlor, Schwermetalle, Dioxine je nach Behandlung). Diese Gifte gefährden Ihre Gesundheit, schädigen die Umwelt und können den Ofen und Schornstein angreifen. Außerdem sind solche Materialien laut Gesetz verboten zu verbrennen – und das aus gutem Grund. Verbrennen Sie ausschließlich naturbelassenes Holz. Auch Pressholz wie Spanplatten oder MDF gehört nicht ins Feuer, ebenso wenig wie Papier mit Farbaufdruck (kein Hochglanzmagazin im Kamin entsorgen!). Selbst Treibholz aus dem Meer ist problematisch: Es enthält oft Salz und andere Ablagerungen, die beim Verbrennen ätzende oder toxische Substanzen bilden können. Halten Sie sich lieber an klassisches Brennholz – Ihr Ofen und Ihre Lunge werden es Ihnen danken.
Zusammengefasst: Im Kamin nur sauberes, trockenes, unbehandeltes Holz verbrennen. Alles andere bitte anderweitig entsorgen.
Nachhaltigkeit und regionale Verfügbarkeit
Holz heizen hat in Zeiten von Klimabewusstsein einen besonderen Charme: Es handelt sich um einen nachwachsenden Rohstoff, der bei verantwortungsvoller Nutzung klimaneutral sein kann. Das Prinzip der Nachhaltigkeit – also nur so viel Holz entnehmen, wie durch Aufforstung wieder nachwächst – stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und wird in Deutschland seit über 300 Jahren praktiziert. In nachhaltig bewirtschafteten Wäldern wird für gefällte Bäume Nachwuchs gepflanzt, und der Holzeinschlag bleibt im Rahmen des Waldwachstums. Wenn Sie also Brennholz aus solch einer Quelle nutzen, wird beim Verbrennen nur das CO₂ freigesetzt, das der Baum zuvor gespeichert hat – unterm Strich ist die CO₂-Bilanz ausgeglichen. Die Wärme aus dem Kamin kommt dann ohne fossile Brennstoffe aus. Wichtig ist natürlich, dass das Holz sauber verbrennt (d.h. trocken und mit ausreichend Luft), denn nur dann bleiben die Emissionen gering. Ein gut eingestellter, moderner Kaminofen mit trockenem Holz kann sehr effizient und relativ sauber arbeiten, sodass Holz als Heizmaterial ökologisch sinnvoll ist.
Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit ist die regionale Verfügbarkeit von Brennholz. Holz wächst vor unserer Haustür – warum also weite Transportwege in Kauf nehmen? Wer lokal kauft (beim Förster, regionalen Brennholzhändler oder dem Landwirt nebenan), spart Transportenergie und unterstützt die heimische Forstwirtschaft. Gerade in Mitteleuropa ist Brennholz ein regionales Produkt: In waldreichen Gegenden bekommt man meist Holz aus den umliegenden Forsten. Fragen Sie ruhig nach der Herkunft – Buchenholz aus dem eigenen Landkreis zum Beispiel hinterlässt einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck als Importholz. Zusätzlich sind kurze Transportwege oft auch günstiger im Preis. Achten Sie beim Kauf auf Zertifikate wie FSC® oder PEFC™, welche bestätigen, dass das Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Diese Siegel geben Sicherheit, dass weder Raubbau an Wäldern betrieben wurde noch unnötig lange Lieferketten anfallen.
Nicht zuletzt bedeutet Nachhaltigkeit beim Heizen mit Holz auch, nur so viel Holz zu verbrauchen wie nötig. Ein überhitztes Wohnzimmer muss nicht sein – wer effizient heizt (z.B. die Luftzufuhr am Ofen richtig einstellt und passend dimensionierte Holzscheite nutzt), schont die Ressourcen und reduziert Emissionen. Und ein Tipp fürs gute Gewissen: Nutzen Sie Holzreste sinnvoll. Dünne Äste oder unbehandeltes Restholz müssen nicht im Müll landen – getrocknet eignen sie sich oft noch als Anmachholz für den Kamin. So wird möglichst alles verwertet.
Preis-Leistungs-Verhältnis und praktische Tipps für Verbraucher
Neben Wohlfühlfaktor und Ökologie spielt natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle: Welches Holz lohnt sich finanziell am meisten, und wie kommt man generell clever an gutes Brennholz? Hier ein paar Hinweise sowie praktische Tipps rund um Kauf, Lagerung und Qualität:
Hartholz vs. Weichholz – was ist günstiger? Auf den ersten Blick ist Weichholz preislich verlockend: Pro Raummeter (ein Ster Holz) kostet z.B. Fichtenholz oft weniger als Buchenholz. Allerdings muss man, wie erwähnt, von Fichte deutlich mehr Menge verfeuern, um die gleiche Heizwirkung zu erzielen. Ein Rechenbeispiel: Etwa 1,3 Raummeter Fichtenholz entsprechen vom Energiegehalt her 1 Raummeter Buchenholz. Wenn also Buche nur geringfügig teurer als Fichte ist (oder sogar gleich kostet, was je nach Region vorkommt), hat Buche klar die Nase vorn – man bekommt mehr Wärme fürs Geld. In der Praxis liegen die Preise pro Raummeter Hartholz zwar höher, aber nicht so dramatisch, dass Weichholz doppelt so billig wäre. Daher ist hochwertiges Hartholz in vielen Fällen preiswerter auf die Heizleistung gerechnet. Am effektivsten fährt man oft mit einem Mix: Günstiges Weichholz (oder Abfallholz aus unbehandeltem Verschnitt) zum Anfeuern und teureres Hartholz für die lange Wärmeerhaltung. So nutzt man die Stärken beider und spart Geld, ohne auf Behaglichkeit zu verzichten.
Große Mengen, geringere Kosten: Wie bei vielen Dingen gibt es auch beim Brennholz Mengenrabatt. Klein verpacktes Kaminholz im Netz oder Karton (oft im Baumarkt oder an der Tankstelle angeboten) ist bequem, aber gemessen am Inhalt recht teuer. Günstiger ist es, Holz in größerer Einheit zu beziehen – etwa als Schüttraummeter lose oder als gestapelter Raummeter. Wer die Möglichkeit hat, einen größeren Holzvorrat zu lagern, sollte davon Gebrauch machen. Oft verkaufen Förster oder lokale Bauern ofenfertiges Holz im Herbst zu fairen Preisen, oder man kauft frisches Holz günstig im Frühjahr und lässt es selbst zu Hause trocknen. Selbstwerber, die mit Motorsäge und Spaltaxt umgehen können, kommen am billigsten weg, indem sie im Wald (mit Genehmigung) Holz aufarbeiten. Allerdings muss man hier Zeit, Mühe und die richtige Ausrüstung einplanen – das ist nicht jedermanns Sache. Ein Mittelweg ist, ofenfertiges Holz (schon gesägt und getrocknet) palettenweise liefern zu lassen. Das kostet mehr als rohe Baumstücke, erspart aber Arbeit. Letztlich sollte jeder abwägen: Habe ich Platz und Zeit, um Holz selbst zu trocknen und zu verarbeiten? Wenn ja, lässt sich viel sparen. Wenn nein, kalkuliert man den höheren Preis für fertig vorbereitetes Brennholz als Komfortaufschlag ein.
Lagerung und Trocknung – so wird’s gemacht: Damit Brennholz seinen vollen Brennwert entfalten kann, muss es richtig gelagert und getrocknet werden. Frisch geschlagenes Holz ist „nass“ und braucht je nach Art 1-3 Jahre Lagerzeit. Der Lagerplatz sollte gut belüftet und vor Regen geschützt sein. Ideal ist ein überdachter Holzstapel an der Süd- oder Westseite des Hauses, wo Sonne und Wind hinkommen, oder ein Holzunterstand (Holzschauer) mit offenen Seiten. Stapeln Sie die Scheite nicht direkt auf den Boden, sondern z.B. auf Paletten oder Lattenroste – so kann Luft von unten zirkulieren und Feuchtigkeit aus dem Boden wird ferngehalten. Zwischen Wand und Holzmiete etwas Abstand lassen, damit auch hier Luft durchstreichen kann. Das Holzschichten selbst kann man kreativ gestalten (rund, längs, Kreuzstapel); wichtig ist nur, dass Regen ablaufen kann und die Stücke nicht zu dicht gepackt sind. Decken Sie die oberste Lage mit einer Plane oder Wellblech ab, seitlich jedoch nicht komplett abdichten – das Holz soll atmen. Kontrollieren Sie den Stapel gelegentlich auf Schimmel oder Schädlinge, insbesondere in den ersten Monaten der Trocknung. Richtig gelagert, sinkt der Feuchtigkeitsgehalt von anfänglich ~50% auf unter 20%. Lufttrockenes Holz erkennt man oft daran, dass es Risse an den Enden zeigt und die Rinde sich leichter löst.
Woran erkennt man gutes Brennholz? Gutes Brennholz ist trocken, sauber und hart. Sie können einige einfache Tests machen: Sehen Sie sich die Scheite an – sind dunkle Verfärbungen oder sogar weißer Schimmel sichtbar, lassen Sie die Finger davon. Gutes Holz hat eine gesunde Holzfarbe und höchstens leichte Grautöne von der Witterung. Fühlen Sie – trockenes Holz ist deutlich leichter als frisch geschnittenes. Heben Sie zwei ähnlich große Scheite verschiedener Anbieter an: das leichtere (bei gleicher Holzart) dürfte trockener sein. Klopfen Sie zwei Stücke aneinander: Ertönt ein helles, klackendes Geräusch, ist das Holz gut trocken; klingt es dumpf oder nass, steckt noch Feuchte drin. Riechen Sie daran – trockenes Holz duftet mild oder kaum, während feuchtes oft einen muffigen Geruch hat. Im Zweifel verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät: Werte unter ca. 18–20% Restfeuchte sind ideal. Scheite mit mehr als 25% sollten unbedingt noch weiter trocknen, bevor sie im Ofen landen. Auch die Holzlänge ist ein Qualitätsaspekt: Seriöse Händler liefern ofenfertiges Holz in Längen, die zu gängigen Öfen passen (meist 25 cm oder 33 cm). Zu lange Scheite, die gar nicht in Ihren Kaminofen passen, nützen wenig – im Zweifel beim Kauf nachfragen. Insgesamt gilt: Investieren Sie lieber in etwas teureres, aber garantiert trockenes Holz als in ein Schnäppchen, das sich als „Halbfeucht“-Partie entpuppt. Letztere bringt Ihnen weniger Heizwert und mehr Ärger.
Praktische Brenntipps: Für den optimalen Abbrand im Kamin können Sie einige Kniffe anwenden. Zum Anzünden des Feuers greifen Sie zu dünnen Scheiten oder Anzündholz – hier leistet Weichholz sehr gute Dienste, da es schnell Feuer fängt. Schichten Sie z.B. ein paar trockene Fichtenscheite oder Tannenzapfen locker als Basis, legen Sie einen Anzünder (Holzwolle-Wachs oder ähnliches) dazu, und stapeln Sie darüber Ihr Hartholz. Die anfängliche schnelle Flamme des Weichholzes entzündet die schwerere Buche oder Eiche zuverlässig. Sobald das Hartholz brennt, genießen Sie eine lange gleichmäßige Feuerphase. Kombinieren Sie also ruhig Holzarten: Die Mischung macht’s! Viele Kaminbesitzer schwören darauf, am Abend zunächst mit etwas Birke oder Fichte eine flotte Flamme zu erzeugen und dann größere Buchenstücke nachzulegen für die Gluthaltung. So bekommen Sie sowohl schnelle Wärme als auch dauerhafte Heizkraft. Achten Sie beim Nachlegen immer darauf, nicht zu viel auf einmal ins Feuer zu geben – das Feuer braucht Sauerstoff. Besser ein, zwei Scheite nachlegen und die Luftzufuhr im Ofen anpassen, als den Kamin vollzustopfen. Und falls Sie einen offenen Kamin haben: Nie unbeaufsichtigt lassen und immer einen Funkenschutz davorstellen, auch wenn Sie nur Hartholz verwenden.
Zum Schluss noch ein Sicherheitstipp: Lassen Sie Ihren Schornstein regelmäßig vom Fachmann reinigen. Selbst mit bestem Holz entstehen im Laufe der Zeit Ablagerungen. Eine saubere Anlage zieht besser, brennt effizienter und minimiert das Risiko von Schornsteinbränden. Außerdem verbrennt gut gewartete Technik den Brennstoff optimaler – was wiederum Holz spart.