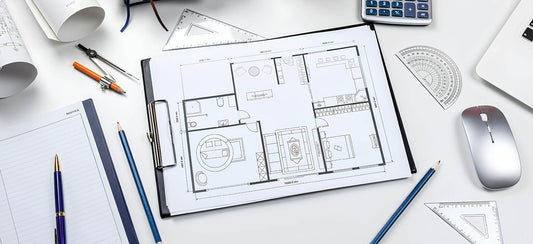Die zehn häufigsten Fehler beim Heizen und wie Sie sie vermeiden
Teilen
Heizen kann richtig ins Geld gehen – und dabei wollen wir doch einfach nur ein behaglich warmes Zuhause, besonders in der kalten Jahreszeit. Viele von uns machen jedoch typische Fehler beim Heizen, die nicht nur die Heizkosten in die Höhe treiben, sondern auch für ein schlechteres Wohnklima sorgen. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Änderungen lassen sich oft schon spürbare Einsparungen erzielen. Im Folgenden haben wir die zehn häufigsten Heizfehler zusammengestellt und erklären, wie Sie diese vermeiden können. So schonen Sie Ihren Geldbeutel, verbessern das Raumklima und tun ganz nebenbei auch der Umwelt etwas Gutes.
Fehler 1: Dauerlüften mit gekippten Fenstern
Frische Luft ist wichtig, doch ein häufiger Fehler ist es, im Winter die Fenster stundenlang auf Kipp stehen zu lassen. Viele glauben, damit für kontinuierliche Belüftung zu sorgen, ohne allzu viel Wärme zu verlieren. In Wahrheit kühlt ein gekipptes Fenster den Raum dauerhaft aus, ohne für einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen. Die Heizung läuft derweil auf Hochtouren, um die einströmende Kälte auszugleichen – Energie geht buchstäblich zum Fenster hinaus.
Besser so: Setzen Sie auf Stoßlüften statt Dauerlüften. Lüften Sie mehrmals täglich kurz, aber gründlich: Drehen Sie die Thermostatventile herunter oder die Heizung aus, öffnen Sie dann alle Fenster für 5 bis 10 Minuten weit. Ideal ist Durchzug, bei dem sich gegenüberliegende Fenster oder Türen öffnen lassen. Dadurch wird die verbrauchte, feuchte Innenluft komplett gegen frische Außenluft ausgetauscht. Die Wände und Möbel kühlen in dieser kurzen Zeit jedoch nicht stark aus, sodass die Räume danach schnell wieder warm werden. Wichtig: Vergessen Sie nicht, während des Lüftens die Heizkörper abzudrehen. Ein Thermostatventil registriert nämlich den Temperaturabfall und würde sonst voll aufdrehen – die Heizenergie geht dann direkt nach draußen verloren.
Übrigens sollten Sie auch im Winter nicht ganz aufs Lüften verzichten. Manche haben aus Angst vor Wärmeverlust die Fenster nahezu dauerhaft geschlossen. Das Ergebnis sind oft beschlagene Fenster und ein stickiges Raumklima. Ohne regelmäßigen Luftaustausch steigt die Luftfeuchtigkeit, was Schimmelbildung begünstigen kann. Daher gilt: regelmäßig, aber richtig lüften – so behalten Sie ein gesundes Wohnklima, ohne unnötig Heizenergie zu verschwenden.
Fehler 2: Heizkörper blockieren oder verdecken
Ein weiterer häufiger Heizfehler ist das Verdecken der Heizflächen. Wenn die Wärme nicht frei in den Raum strömen kann, wird das Zimmer nicht richtig warm, obwohl die Heizung eigentlich genug leisten würde. Typische Beispiele: Ein Sofa steht direkt vor dem Heizkörper, lange Vorhänge hängen darüber, oder man hat eine dekorative Verkleidung montiert. Auch auf dem Heizkörper zum Trocknen ausgebreitete Wäsche zählt dazu.
In all diesen Fällen staut sich die Wärme. Der Thermostat misst zwar vielleicht die Soll-Temperatur (wenn er nicht ebenfalls verdeckt ist), aber der Rest des Raumes bleibt kühl. Die Folge: Man dreht das Thermostat höher als nötig oder die Heizanlage läuft länger, um doch die gewünschte Temperatur zu erreichen – es wird Energie verschwendet.
Besser so: Lassen Sie Ihren Heizkörpern Luft zum "Atmen". Stellen Sie Möbel mit etwas Abstand auf (einige Zentimeter Abstand zur Heizung reichen oft schon, um die Luft zirkulieren zu lassen). Verwenden Sie kürzere Vorhänge oder legen Sie lange Vorhänge beim Heizen so zur Seite, dass sie nicht direkt über dem Heizkörper hängen. Wäsche sollten Sie möglichst auf einem Wäscheständer in einem gut gelüfteten Raum trocknen statt direkt auf dem Radiator – das schont auch die Luftfeuchtigkeit im Raum.
Vergessen Sie nicht, auch Staub und Schmutz von Heizkörpern oder Lüftungsschlitzen zu entfernen. Eine dicke Staubschicht wirkt wie eine Isolierung und mindert die Wärmeabgabe. Bei einer Fußbodenheizung sollten Sie ebenfalls darauf achten, keine dicken Teppiche großflächig darauf zu legen, da auch diese die Wärmeabgabe bremsen können.
Fehler 3: Thermostat falsch bedienen
Viele von uns haben es schon getan: Es ist kalt im Raum, also wird das Heizungsventil sofort auf die höchste Stufe gestellt – in der Hoffnung, dass es dann schneller warm wird. Doch das ist ein Irrtum. Ein Thermostatventil funktioniert nicht wie ein Gaspedal, sondern eher wie ein Temperaturwächter. Die Zahlen (oder Stufen) darauf entsprechen bestimmten Ziel-Temperaturen. Beispielsweise steht Stufe 3 bei den meisten Thermostatventilen für ca. 20 °C Raumtemperatur. Wenn Sie das Ventil auf 5 stellen, ändern Sie damit nicht die Heizleistung an sich – Sie stellen nur ein, dass der Raum am Ende etwa 28 °C heiß werden soll. Die Heizung gibt bereits auf Stufe 3 alles, bis ~20 °C erreicht sind. Höher drehen macht den Raum also nicht schneller warm, sondern höchstens wärmer als gewollt, wenn man vergisst, rechtzeitig zurückzudrehen. Das Resultat: überhitzte Räume und verschwendete Energie.
Ein ähnlicher Fehler ist das ständige Auf- und Zudrehen der Heizungsventile. Einige Leute drehen die Heizung komplett ab, wenn es ihnen zu warm ist, und später wieder voll auf, wenn es kalt wird. Dabei regelt ein Thermostatventil die Temperatur automatisch, sobald Sie eine bestimmte Stufe eingestellt haben – es schließt, wenn die Wunschtemperatur erreicht ist, und öffnet wieder, wenn es abkühlt. Wenn Sie ständig manuell eingreifen, arbeiten Sie praktisch gegen die Automatik und riskieren unnötige Temperaturschwankungen.
Besser so: Wählen Sie an jedem Heizkörper eine angemessene Thermostat-Einstellung und lassen Sie die Regelung dann von alleine arbeiten. Für Wohnräume sind meist Stufe 2,5 bis 3,5 (je nach gewünschter Temperatur um die 18–22 °C) ideal. Drehen Sie nicht gleich auf Maximum, nur um vermeintlich schneller aufzuwärmen – schließen Sie lieber Türen zum Kalten oder kuscheln Sie sich in eine Decke, bis die Temperatur erreicht ist. Nutzen Sie auch die Programmiermöglichkeiten: Moderne Thermostatventile oder zentrale Heizungsregler kann man so einstellen, dass die Temperatur nachts oder während der Arbeitszeit automatisch abgesenkt wird und rechtzeitig vor dem Aufstehen bzw. Heimkommen wieder steigt. Das ist komfortabel und spart Heizenergie, ohne dass Sie ständig von Hand regulieren müssen.
Fehler 4: Keine regelmäßige Wartung der Heizanlage
"Never change a running system" – das denken sich viele Hausbesitzer und Mieter, wenn es um die Heizung geht. Läuft der Kessel oder die Therme scheinbar problemlos, wird Jahr für Jahr geheizt, ohne einmal einen Check durchzuführen. Doch die Vernachlässigung der Heizungswartung ist ein großer Fehler. Mit der Zeit sammeln sich in einer Heizungsanlage Ablagerungen, und Verschleißteile nutzen sich ab. Ein schlecht gewarteter Brenner verbrennt den Brennstoff (sei es Gas, Öl oder Pellets) weniger effizient. Auch die Steuerung und Regelung der Anlage kann im Laufe der Zeit "verstimmen". Die Folge: Die Heizung verbraucht mehr Energie als nötig, und im schlimmsten Fall fällt sie genau im tiefsten Winter aus.
Besser so: Gönnen Sie Ihrer Heizung mindestens einmal im Jahr eine Inspektion durch einen Fachmann. Viele Hersteller schreiben eine jährliche Wartung sogar vor, um Garantieansprüche zu erhalten. Bei der Wartung wird der Brenner gereinigt und optimal eingestellt, Filter werden gewechselt (z.B. Ölfilter oder Luftfilter bei Wärmepumpen/Lüftungsanlagen), Pumpen und Ventile werden überprüft und der Schornsteinfeger misst die Abgaswerte. Eine gut gewartete Heizanlage arbeitet effizienter und zuverlässiger. Das verlängert auch die Lebensdauer Ihrer Anlage. Planen Sie diese Wartung idealerweise vor Beginn der Heizsaison ein – so starten Sie mit einem optimal eingestellten System in den Winter.
Fehler 5: Heizkörper nicht entlüften
Gluckernde oder nur halb warme Heizkörper sind ein deutliches Warnsignal: In Ihrem Heizkreislauf befindet sich Luft. Luftblasen im Heizkörper verhindern, dass das warme Wasser die gesamte Fläche erwärmen kann. Die obere Hälfte bleibt dann oft kalt, während unten heißes Wasser zirkuliert. Viele ignorieren dieses Anzeichen oder schieben das Entlüften auf – ein Fehler, der Heizenergie verschwendet und den Heizkomfort mindert.
Besser so: Prüfen Sie zu Beginn jeder Heizperiode alle Heizkörper und achten Sie darauf, ob es Blubbergeräusche gibt. Fühlen Sie auch, ob der Heizkörper überall gleichmäßig warm wird. Falls nicht, steht eine Entlüftung an. Das ist kein Hexenwerk: Sie benötigen lediglich einen passenden Heizungsentlüftungsschlüssel (ein kleines Vierkantschlüsselchen) und ein altes Tuch oder eine Schale. Drehen Sie den Heizkörper voll auf (damit genügend Druck im System ist) und öffnen Sie vorsichtig das Entlüftungsventil am Heizkörper. Halten Sie das Tuch darunter, denn sobald die Luft entwichen ist, tritt etwas Heizwasser aus. Sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl kommt, schließen Sie das Ventil wieder. Sie werden merken: Der Heizkörper wird nun wieder vollständig warm. Vergessen Sie nicht, anschließend den Wasserdruck Ihrer Heizanlage zu prüfen (bei Zentralheizungen mit eigenem Wasserkreislauf) – durch das Entlüften muss man ggf. Wasser nachfüllen, damit genug Druck im System bleibt.
Diese Prozedur sollte man mindestens einmal jährlich durchführen, am besten zu Beginn der Heizsaison. So stellen Sie sicher, dass alle Heizflächen optimal genutzt werden. Wenn Sie das Entlüften nicht selbst machen möchten, kann das auch der Heizungsinstallateur im Rahmen der Wartung übernehmen. Das Ergebnis lohnt sich: Sie haben gleichmäßig warme Räume und keine gluckernden Geräusche mehr – und die Heizenergie kann voll im Raum wirken, statt in kalten Luftpolstern stecken zu bleiben.
Fehler 6: Unnötiges Beheizen ungenutzter Räume
Warum ein Gästezimmer konstant auf 22 °C heizen, wenn dort kaum jemand ist? Viele Haushalte behandeln alle Räume gleich, unabhängig davon, ob sie regelmäßig genutzt werden oder nicht. Das kann ein teurer Luxus sein. Ein selten genutztes Zimmer muss nicht dieselbe Wohlfühltemperatur haben wie das Wohnzimmer, in dem man sich ständig aufhält. Jeder zusätzliche Quadratmeter, den Sie voll mitheizen, kostet Energie und Geld.
Besser so: Heizen Sie bedarfsgerecht. In Räumen, die Sie kaum nutzen (zum Beispiel Abstellkammer, Gästezimmer, selten benutztes Arbeitszimmer), können Sie die Thermostate ruhig etwas niedriger einstellen. Es genügt oft, solche Räume auf etwa 16 °C zu halten statt auf 20–22 °C. Diese sogenannte Grundtemperierung stellt sicher, dass es dort nicht eiskalt wird (wichtig gegen Feuchtigkeit und Schimmel, siehe nächster Punkt), spart aber im Vergleich zur Komplettbeheizung spürbar Energie. Wichtig ist, die Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen zu halten, damit nicht ständig Wärme aus den warmen Wohnbereichen dort hineinströmt. Wenn Besuch kommt oder Sie den Raum doch einmal nutzen wollen, können Sie die Heizung immer noch einige Stunden vorher höher drehen.
Übrigens: Wenn Sie Zimmer komplett ungenutzt lassen, drehen Sie die Heizung aber nicht ganz auf Null. Lassen Sie mindestens die Frostschutz-Einstellung oder eine niedrige Stufe aktiv, damit der Raum nicht völlig auskühlt. So vermeiden Sie Schäden durch Frost und halten eine Grundwärme.
Fehler 7: Räume völlig auskühlen lassen
Das Gegenteil vom vorherigen Punkt kann allerdings ebenso problematisch sein: Manche lassen Räume oder die ganze Wohnung phasenweise völlig auskühlen, um Heizkosten zu sparen. Nach dem Motto "Nachts wird nicht geheizt, morgens drehe ich dann wieder auf" oder "Wenn ich außer Haus bin, bleibt die Heizung komplett aus". Zwar spart man kurzfristig Energie, wenn die Heizung aus ist – aber das vollständige Auskühlen birgt Risiken und kann am Ende sogar mehr Energie kosten.
In kalten, unbeheizten Räumen sinkt die Temperatur der Wände und Möbel stark ab. Kühle Wände ziehen Feuchtigkeit an: Die warme Luft aus anderen Räumen oder vom Kochen und Duschen kondensiert an den kalten Oberflächen. So entstehen feuchte Ecken und im schlimmsten Fall Schimmel, besonders in Schlafräumen oder unbeheizten Kellern. Zudem braucht die Heizung sehr lange und viel Energie, um einen ausgekühlten Raum wieder auf angenehm warm zu bringen. Die Heizkörper und Wände müssen ja erst einmal die Kälte "wegheizen". Was man über Stunden an Heizenergie eingespart hat, wird dann in kurzer Zeit mit hoher Leistung wieder verbraucht.
Besser so: Lassen Sie die Wohnung nie komplett auskühlen. Es ist sinnvoll, die Temperatur abzusenken, aber in Maßen. Nachts können Sie beispielsweise die Raumtemperatur um ein paar Grad reduzieren (etwa von 21 °C auf 17 °C) – dafür gibt es oft sogar automatische Nachtabsenkungs-Funktionen an Thermostaten oder der Heizungssteuerung. Wenn Sie außer Haus sind (Arbeit, Urlaub), halten Sie eine Grundtemperatur von etwa 15–16 °C. So vermeiden Sie ein Auskühlen der Bausubstanz. Die Räume bleiben leicht temperiert und trocknen nicht aus, und bei Wiederkehr ist schneller wieder Behaglichkeit erreicht.
Denken Sie auch hier daran: In angrenzenden beheizten Räumen die Türen geschlossen halten, damit nicht ständig Warmluft in einen kälteren Bereich strömt. Und lüften Sie selbst kühle Räume ab und zu, um Feuchtigkeit hinauszubefördern – natürlich nur kurz, damit sie nicht noch mehr auskühlen.
Fehler 8: Unpassende Raumtemperaturen wählen
Manchmal wird aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit in allen Räumen die gleiche Temperatur gehalten – oder man heizt nach dem Motto "viel hilft viel" und überheizt bestimmte Räume. Beides ist nicht optimal. Jede Raumart hat eine empfohlene Temperatur, bei der sich Zweck, Komfort und Effizienz die Waage halten.
Ein häufiges Beispiel: Im Wohnzimmer möchte man es gern gemütlich warm haben – aber muss es wirklich 24 °C sein? Für die meisten Menschen sind 20–21 °C in Wohnräumen völlig ausreichend. Jedes Grad mehr steigert den Energieverbrauch um etwa 6 %. Das läppert sich, vor allem über einen ganzen Winter.
Im Schlafzimmer bevorzugen viele eine kühle Temperatur zum Schlafen – das ist grundsätzlich sinnvoll, aber unter 16 °C sollte es dort auch nicht kalt werden. Sonst drohen Feuchteprobleme, und morgens fällt das Aufstehen in der Kälte umso schwerer. Eine Temperatur von etwa 17–18 °C sorgt für ein angenehmes Schlafklima, ohne dass es klamm wird.
Auch Küche und Bad brauchen keine durchgehende Maximalheizung. In der Küche genügt oft eine niedrigere Grundtemperatur (etwa 18–19 °C), da beim Kochen und durch Geräte bereits Wärme entsteht. Im Badezimmer möchte man es zwar warm und wohlig, während man darin ist (um 22–24 °C beim Duschen oder Baden), aber man muss das Bad nicht den ganzen Tag auf diesem Niveau halten, wenn es nur morgens und abends genutzt wird. Zwischenzeitlich kann die Temperatur dort ruhig auf etwa 18 °C absinken, ohne dass es unangenehm wird.
Richtwerte für Raumtemperaturen:
- Wohnzimmer / Aufenthaltsräume: ca. 20–22 °C
- Küche: ca. 18–20 °C
- Schlafzimmer: ca. 17–18 °C
- Badezimmer: ca. 22–24 °C bei Nutzung, sonst ca. 18 °C
- Flur / Treppenhaus: ca. 15–18 °C
Natürlich sind das nur Empfehlungen. Jeder empfindet Temperaturen etwas anders. Wichtig ist jedoch, sich bewusst zu machen, dass ein stark überhitzter Raum nicht nur die Haut austrocknen lässt und zu trockener Luft führt, sondern eben auch den Energieverbrauch in die Höhe treibt. Andererseits sollten Räume, insbesondere solche mit Außenwänden, nicht zu kalt werden (unter ca. 16 °C), damit keine Feuchtigkeit kondensiert. Finden Sie einen vernünftigen Mittelweg – oft hilft es schon, den Thermostat im Wohnzimmer ein kleines Stück herunterzudrehen und stattdessen einen Pulli überzuziehen. Sie werden es kaum merken, aber auf Dauer macht es einen Unterschied in der Heizkostenabrechnung.
Fehler 9: Wärme entweicht ungehindert (Wärmeverlust ignorieren)
Manchmal liegt der Heizfehler gar nicht direkt an der Heizungsanlage oder dem Heizverhalten, sondern an der Wohnung selbst. Wenn warme Luft oder Heizwärme ungehindert nach draußen entweichen kann, heizen Sie sprichwörtlich "für draußen". Typische Schwachstellen sind undichte Fenster und Türen, schlecht isolierte Wände oder Dächer, Rollladenkästen ohne Dämmung und Spalten unter Türen. Auch ungedämmte Heizungsrohre in kalten Kellern oder an Außenwänden führen zu unnötigen Wärmeverlusten.
Besser so: Dichten Sie Ihr Zuhause soweit möglich gegen Wärmeverluste ab. Das heißt nicht, dass Sie gleich die Wände aufreißen müssen – oft helfen schon kleine Maßnahmen: Bringen Sie selbstklebende Dichtungsbänder an zugigen Fenstern und Türen an, um Spalten zu schließen. Über Nacht sollten Sie Vorhänge zuziehen oder Rollläden herunterlassen; das reduziert den Wärmeverlust über die Fenster spürbar. Achten Sie darauf, dass Türen zu unbeheizten Räumen oder zum Treppenhaus geschlossen bleiben, damit die warme Luft nicht dauerhaft dorthin entweicht. Ein weiterer Tipp: Dämmfolie hinter dem Heizkörper – wenn ein Heizkörper an einer kalten Außenwand sitzt, kann eine dünne, aluminumbeschichtete Dämmmatte dahinter helfen, die Wärme zurück in den Raum zu reflektieren, statt die Außenwand zu erwärmen.
Sollten Sie in einem Eigenheim wohnen, lohnt sich auch ein Blick auf die größeren Wärmelecks: Ist das Dach gedämmt? Sind die Heizungsrohre im Keller isoliert, damit sie nicht den Keller statt die Zimmer wärmen? Solche Maßnahmen sind zwar aufwändiger, machen aber einen erheblichen Unterschied im Energieverbrauch. In einer Mietwohnung hat man darauf oft wenig Einfluss – hier kann man zumindest die einfachen Dinge umsetzen (Fenster abdichten, Vorhänge nutzen etc.) und im Zweifel den Vermieter auf größere Mängel hinweisen. Jede vermiedene Wärmebrücke spart Heizenergie und verbessert das Wohngefühl, weil es weniger Zugluft und Kälteflächen gibt.
Fehler 10: Auf Komfort und moderne Technik verzichten
Unser letzter Punkt betrifft die Bequemlichkeit – oder manchmal auch Unkenntnis –, dass wir nicht die Helferlein nutzen, die uns das effiziente Heizen leichter machen. Dazu gehört zum Beispiel die Programmierung der Heizung. Wenn Ihre Thermostate oder Ihre Heizungsanlage Zeitschaltprogramme erlauben, sollten Sie diese nutzen. Viele lassen jedoch ihre Heizung den ganzen Tag über auf derselben Einstellung laufen, selbst wenn stundenlang niemand zuhause ist. Andere wiederum heizen tagsüber kaum und drehen abends plötzlich voll auf, statt die Wärme gleichmäßiger zu verteilen. Dabei könnten moderne Heizungssteuerungen (oder smarte Thermostatventile) automatisch für Ausgleich sorgen: Sie senken z.B. nachts oder bei Abwesenheit die Temperatur ab und fahren sie rechtzeitig wieder hoch, bevor Sie heimkommen. So ist es immer angenehm, wenn Sie es brauchen – und in der Zwischenzeit wird Energie gespart.
Auch das Thema Smart Home steckt voller Möglichkeiten: vom Thermostat, das Sie per App steuern können, bis zur intelligenten Einzelraumregelung, die lernt, wie Ihr Zuhause am effizientesten warm wird. Solche Technik ist kein Spielkram, sie kann handfeste Energieeinsparungen bringen, wenn man sie richtig einsetzt. Aber viele scheuen sich davor, die alten Thermostate zu ersetzen oder die Bedienungsanleitung der Heizungssteuerung zu studieren – aus Angst, etwas falsch zu machen, oder weil es auf den ersten Blick kompliziert scheint.
Besser so: Trauen Sie sich an die Technik heran oder holen Sie sich Hilfe. Schon einfache elektronische Thermostatköpfe, die man gegen die alten manuell einstellbaren austauscht, kosten nicht die Welt und ermöglichen Zeitprogramme für jeden Heizkörper. Die Installation ist in der Regel unkompliziert (oft kann man das selbst machen, ohne das Heizungswasser ablassen zu müssen). Wenn Sie Mieter sind, sprechen Sie mit dem Vermieter, bevor Sie tauschen – aber viele Vermieter begrüßen Maßnahmen, die den Energieverbrauch senken. In Eigenheimen können Sie noch mehr optimieren: Lassen Sie sich vom Heizungsinstallateur zeigen, welche Einstellungen Ihre Heizungsregelung bietet (zum Beispiel Heizkurven bei Fußbodenheizungen einstellen, Außentemperaturfühler nutzen, Nachtabsenkung programmieren). Auch ein hydraulischer Abgleich durch den Fachmann kann helfen – dabei wird der Wasserdurchfluss im Heizsystem so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig versorgt werden, ohne dass manche Heizkörper zu viel und andere zu wenig Heizwasser abbekommen. Das initiale Investment in moderne Technik oder Optimierung macht sich durch einen effizienteren Heizbetrieb bezahlt.
Zum Komfort gehört übrigens auch, mal ein Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser) und Thermometer aufzustellen: So behalten Sie das Raumklima im Blick. Viele neigen dazu, "nach Gefühl" zu heizen oder zu lüften. Besser ist es jedoch, zu wissen: Wie kalt ist es wirklich im Raum? Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? So lüften und heizen Sie gezielter, um angenehme 40–60 % Luftfeuchtigkeit und etwa 20 °C Raumtemperatur zu halten. Zudem merken Sie schnell, wenn etwas aus dem Ruder läuft (etwa zu feuchte Luft in einem zu kalten Raum).
Heizen muss kein Buch mit sieben Siegeln sein. Mit gesundem Menschenverstand und den oben genannten Tipps lassen sich die gängigsten Fehler leicht vermeiden. Oft sind es kleine Verhaltensänderungen – das Fenster richtig lüften, den Thermostat sinnvoll einstellen oder die Türen schließen –, die bereits eine große Wirkung zeigen. Dadurch bleibt es zuhause kuschelig warm, ohne dass die Heizkosten explodieren. Gleichzeitig leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz, denn jede eingesparte Kilowattstunde Heizenergie reduziert den CO₂-Ausstoß. Kurz gesagt: Clever heizen heißt komfortabel wohnen und dabei Geld und Ressourcen sparen. Probieren Sie es aus – Ihr Geldbeutel und Ihr Wohnklima werden es Ihnen danken!